„Pain is temporary“, so heißt es immer wieder und das soll daran erinnern, dass aller Schmerz letztlich vergessen ist in Anbetracht der Leistungen, die unter ihm vollbracht wurden. Das mag vermutlich sogar stimmen, aber „temporary“ ist da manchmal auch bloß ein relativer Begriff. Passionierte Risskletterer werden das verstehen, denn so verlockend die Aussicht auf das Klettern selbst, auf die überwundenen Schwierigkeiten und die erreichten Ausblicke auch sein mag – so schnell geht der Schmerz dann mitunter doch nicht vorüber. Andererseits – warum sollte das ein Hindernis darstellen, wenn spektakuläre Erfahrungen in ebenso spektakulären Klettergebieten warten? Ein Ausflug in die Felslandschaften des US-Staates Utah und die Welt des Risskletterns.
Die andere Klettererfahrung
Rissklettern oder die Spezialform Piazen (nach dem italienischen Bergführer Giovanni Piaz) oder auch „la methode dülfer“ (verwirrenderweise nach einem deutschen Bergsteiger) – verschiedene Namen für ein und dieselbe Weise des Kletterns. Bei der Piaz-Technik wird der Halt entlang einer schmalen Felsspalte mit Fingern, Händen und Armen gesucht, unterstützt von den an der Wand abgedrückten Füßen und nach hinten verlagertem Körpergewicht.
Tatsächlich gibt es zwar Spezialisten, die vorzugsweise beim Rissklettern die Höhe und die Herausforderung suchen, etwa die beiden Briten Pete Whittaker und Tom Randall. Es gereicht allerdings generell keinem Kletterer zum Nachteil, die Grundlagen zu beherrschen – Rissausstiege können an jeder Wand vorkommen und sollten nicht das vorzeitige Ende einer ansonsten erfolgreichen Besteigung darstellen müssen. Es schadet also nicht, sich mit den unterschiedlichen Anforderungen von Kaminen, Schulter- und Armrissen, Faust-, Hand- und Fingerrissen oder Hangelrissen auseinanderzusetzen.
Die Voraussetzungen – abgesehen davon, schon mal mit dem Erklettern eines Kamins Erfahrung gesammelt zu haben – sind Kondition und kräftige Muskeln. Die Technik ist nämlich nicht nur schmerzhaft wegen des Kontakts zum Fels, der sich durch die Enge der Risse nun wirklich nicht vermeiden lässt (er ist vielmehr elementare Grundlage), sondern auch wegen der Anstrengungen, die sie mit sich bringt. Damit ist auch gleich eine weitere wichtige Eigenschaft benannt – ein Mindestmaß an Bereitschaft, Schmerzen auszuhalten, muss ebenfalls vorhanden sein.
Überblick: Rissbreiten und die jeweiligen Techniken
Fingerriss: Wie alle nachfolgenden Breiten gibt der Name schon einen sehr genauen Eindruck davon, wieviel Körper in den Riss hineinpasst. In diesem Fall folgerichtig nur die Finger, um mit ihnen Halt zu finden, wird die Hand außerdem leicht verdreht.
Schmalhand: Diese Zwischengröße kann sich als recht unangenehm erweisen, Festklemmen funktioniert eigentlich nur, indem Finger und Daumen verhebelt werden – was die Angelegenheit nur zusätzlich anstrengend macht.
Handriss: Die „angenehmste“ Breite, in der Hauptsache deshalb, weil sie für das Klemmen eine große Kontaktfläche zwischen Hand und Fels erlaubt und damit einen bestenfalls minimalen Kraftaufwand ermöglicht. Bei Handrissen gibt es zwei verschiedene Techniken:
- Symmetrische, gerade Risse können mit einer Hand über der anderen, mit nach oben zeigenden Daumen erklommen werden.
- Bei Neigungen, Verscheidungen oder schlechten Voraussetzungen für das Klemmen, kann „auf rechts“ (oder wahlweise „auf links“) geklettert werden. Das heißt, die rechte Hand liegt unten, der Daumen zeigt nach oben; die linke Hand liegt darüber, mit nach unten gekehrtem Daumen. Die rechte Hand wird dann lediglich nachgesetzt, die Linke bleibt also jederzeit oben.
- Ohne Fußarbeit geht es selbstverständlich auch nicht – die werden überschlagend getreten, für sicheren Halt wird die Fußspitze in den Riss geschoben und verdreht.
Breithand- und Faustriss: Die beiden fallen ebenso in die Rubrik Zwischenbreite und sind etwas schwieriger zu meistern als ein wirklich guter Handriss. Gutes Faustklemmen ist dabei noch deutlich zeitaufwendiger als das Klettern mit Breithandrissen.
Armriss: Werden die Risse breiter, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad. Beim Armriss funktioniert das Klemmen mit der Faust nicht mehr und bisweilen passt aber auch das Knie nicht hinein. Hier kommt es noch mehr auf die richtige Technik an.
Körperriss: Hier passt theoretisch der Körper hinein, was gleichzeitig bedeutet, dass der Übergang zu einem engen Kamin fließend ist. Der Bewegungsspielraum im Körperriss ist allerdings nicht so groß, der Platz reicht vielmehr gerade dazu aus, den Körper darin zu verklemmen.
Piazriss: Bei diesen oft in Verschneidungen anzutreffenden Rissen, arbeitet man sich mit Gegendruck den Riss hinauf. Die Hände halten die Risskante und mit den Beinen drückt man an die andere Wandseite des Risses.
Offwidth: Diese Risse sind für Anspruchsvolle – zu breit für ein Verklemmen der Faust, zu schmal für den Körper. Das erfordert besonderes technisches Geschick, bewährt haben sich vor allem die Double-Fist-Technik (bei der beide Fäuste verklemmt werden) und die Butterfly-Methode (dabei werden beide Hände in den Riss gespreizt).
Darüber hinaus gibt es durchaus noch andere Rissbreiten, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie mehr Körpereinsatz erfordern – im Sinne von, es muss beispielsweise der Arm bis zur Schulter eingesetzt werden oder eine Kombination aus Faust und Hand. Darauf muss man sich allerdings einstellen, denn natürlich sind die Risse selten auf ihrer gesamten Länge gleichmäßig breit.
Das Meistern von verschiedenen Übergängen ist daher die noch größere Herausforderung. Immerhin: Im Normalfall können diese Herausforderungen schon vor dem Beginn des Kletterns abgeschätzt werden. Richtig einschätzen sollten gerade Anfänger aber auch den potenziellen Frustfaktor, der beim Erlernen der grundlegenden Techniken dazugehört. Allerdings muss sich anschließend auch niemand darüber wundern, wie schmerzhaft das Rissklettern sein kann.
Utah und seine Canyons
Zugegeben, es muss nicht immer der weite Weg sein, um eine Gelegenheit zum Rissklettern zu finden. In Europa gibt es einige lohnens- und sehenswerte Ziele, unter denen Cadarese im Piemont besondere Beliebtheit genießt. Dennoch gibt es für Risskletterer einige Klassiker, die dem Erfahrungsschatz nach Möglichkeit einverleibt werden sollten. Etwa die auf dem nordamerikanischen Kontinent, präzise gesagt in dessen Westen. Der hat das Prädikat „wild“ nicht umsonst erhalten und auch wenn damit normalerweise die chaotischen Zustände früherer Tage gemeint sind, so beschreibt es doch ebenso gut die landschaftlichen Vorzüge dieses Teils der USA. Hier liegen die berühmten Nationalparks und Canyons und nicht zuletzt einige der – wenn nicht sogar die – spektakulärsten Rissklettergebiete der Welt.
An dieser Stelle ein schneller Schnitt nach Utah. Warum ausgerechnet der Mormonen-Staat? Weil er einige der wahrscheinlich beeindruckendsten Landschaftszüge und Nationalparks überhaupt vorweisen kann. So karg weite Teile des Bundesstaates bisweilen auch sein mögen, wer sich für einzigartige Felsformationen begeistern kann, ist hier genau richtig: Der Arches-Nationalpark, die Canyonlands, der Zion-Nationalpark, das Monument Valley – sie vermitteln einen Eindruck davon, was hier auf passionierte Kletterer wartet. Die sollten keinesfalls Ausflüge zum Indian Creek und die Slot Canyons des Zion Nationalparks verpassen. Eine gute Ausgangsposition bietet hierzu das Städtchen Moab, das zwar lediglich eine überschaubare Größe, dafür aber eine relative Nachbarschaft etwa zu den Rissen von Indian Creek (etwa eine Stunde Fahrtzeit)
Bildergalerie: Der Riss ins Glück: Rissklettern in Utahs Canyons
Was es für den Ausflug in die Risskletterregionen Utahs braucht
· Vor dem Abflug:
Einige Beachtung sollte in jedem Fall die richtige Reisezeit bekommen. Frühling und Herbst bieten sich an, das Frühjahr hat den nicht zu verachtenden Vorteil, etwas wärmer zu sein – da die Temperaturen in Utah generell extrem ausfallen können (in beiden Richtungen) ist das also zu bedenken.
Keinesfalls vergessen: Sich rechtzeitig mit den amerikanischen Einreisebestimmungen auseinanderzusetzen. Ein Visum ist für einen reinen Touristenaufenthalt zwar nicht notwendig, sehr wohl nötig ist aber die Einreiseerlaubnis per Electronic System for Travel Authorization.
Es macht wahrscheinlich auch schon vor der Abreise Sinn, sich auf einen möglicherweise größeren Materialverbrauch einzustellen – damit erspart man sich vor Ort das Ärgern, vielleicht doch zu wenige Cams und Friends dabei zu haben, um das Erklettern eines besonders attraktiven Risses angehen zu können. Glaubt man den Diskussionen in verschiedenen Kletter-Foren, kann es sich aber rein finanziell auch lohnen, die Ausrüstung erst vor Ort zu erstehen – die vielfache Meinung lautet, dass Friends und Cams in den USA günstiger zu bekommen sind.
Last but not least: Die Frage, welche Rissregionen denn überhaupt angesteuert werden sollen. Da können schon rechtzeitig Informationen eingeholt werden. Einen recht vollständigen Überblick der Möglichkeiten bietet etwa climbing.com mit dem Moab, Utah Rock Climbing Destination Guide. Hilfreich sind möglicherweise auch Kletterführer wie „High on Moab“ von Karl Kelley (2014) und/oder „Rock Climbing Utah“ von Stewart M. Green (2012).
· Vor Ort:
Ohne geht nichts: Der Reiz von Utahs Landschaft liegt unter anderem in ihrer Weite. Das ist wunderschön anzusehen, aber fußläufig eben auch nicht zu durchmessen. Ohne Auto ist man daher aufgeschmissen, selbst der Weg noch Moab von einem der Flughäfen in Denver oder Salt Lake City dürfte sich ansonsten schwierig gestalten. Um die Klettergebiete zu erreichen, empfiehlt sich sogar ein geländetaugliches Gefährt. In dieser Hinsicht werden Kletterwillige nicht darum herum kommen, sich mit einem Mietwagen zu versorgen.
Die ausreichende Versorgung mit Trinkwasser muss übrigens in Eigenverantwortung gewährleistet werden. Das ist beispielsweise in Indian Creek nicht mehr zu bekommen, wenn man einmal da ist. Also das Auto besser gleich mit genügend Vorräten bestücken.
Auf den Trips in die Canyons empfiehlt sich das Mitführen von Desinfektionsmitteln. Egal wie ausgefeilt die Schutzmaßnahmen für die Hände auch sein mögen, es wird niemals gänzlich ohne Verletzungen gehen (und die betreffen schließlich nicht allein die Hände). Das trockene Klima erhöht jedoch die Gefahr von Entzündungen und erschwert das Verheilen. Nichts, was man im Kletter-Urlaub riskieren möchte.
Es ist dringend angeraten, die Verhaltensregeln in den Klettergebieten einzuhalten. Die englischsprachige Seite der „Friends of Indian Creek“ kann hierzu etwa schon einige Hinweise für das korrekte Klettern und Campen geben.
Bei den besonders beliebten Routen muss gegebenenfalls auch mal mit Wartezeiten gerechnet werden. Es sind allerdings ausreichend Alternativen vorhanden.
Indian Creek
Die hier zu findenden Sandsteinfelsen – genannt „Wingate Sandstone“ – sind sehr glatt und haben damit nur wenig Struktur. Wer sich an ihnen versuchen möchte, wird sehr schnell feststellen, dass das Rissklettern ohnehin die nahezu einzige Möglichkeit ist, in die Höhe zu kommen.
Als wäre das nicht Herausforderung genug, lassen sich außerhalb der Risslinien im Prinzip keine Trittmöglichkeiten finden, die ein Antreten erlauben würden. Auf der anderen Seite macht genau das natürlich den besonderen Reiz aus. Hier wird Risskletterern technisch alles abverlangt. Ein Trost vielleicht, abgesehen vom Erlebnis selber: Die Rissrouten von Indian Creek sind eine gute Trainingseinheit, sollte auch das „Tower Climbing“ in den Canyonlands auf dem Programm stehen. Ein Highlight hier und ebenfalls von Moab gut zu erreichen (die Fahrtzeit beträgt etwa anderthalb Stunden) ist beispielsweise der Taylor Canyon mit seinem Moses Tower.
Ansonsten bietet aber schon Indian Creek genug Möglichkeiten, die Grenzen der eigenen Fähigkeiten auszutesten. Dabei sollte allerdings nicht davon ausgegangen werden, die verschiedenen Offwidths, also die weiten Rissen wie den Century Crack, in ähnlicher Manier wie die „Wideboyz“ zu erklimmen. Allerdings besteht dazu selbstverständlich auch keinerlei Notwendigkeit.
Ausflugsziel am Rande: Castle Valley
In der Nachbarschaft von Moab lässt sich aber nicht nur Indian Creek finden, sondern auch die Risslinien des Castle Valley. Das ist nicht nur für Kletterer ein Erlebnis, denn hier zeigt sich auf eindrucksvolle Weise das Wirken des Colorado River, das ganze Tal wird eingefasst von schneebedeckten Bergen. Die perfekte Kulisse für das „Tower Climbing“, wozu mit dem Castleton Tower ein weiterer Klassiker des Risskletterns kommt, der mindestens eine Begutachtung wert ist. Daneben warten mit „The Rectory“ und „Fine Jade“ gleich zwei weitere Hochkaräter.
Zion Nationalpark
Wen es danach noch weiter zieht, wird im Zion Nationalpark ein reichhaltiges Angebot fordernder und sehenswerter Risse vorfinden. Allerdings auch teils abenteuerliche Bedingungen: An vielen Stellen haben die Risse eine nicht unbedingt förderliche Dekoration aus Pflanzenwuchs, in Führern beschriebene Routen weisen bei genauerer Betrachtung dann doch nur eine Handvoll oder gar eine frühere Begehung auf. Je nach Anreisezeit ist zudem die Temperatur nicht ganz unproblematisch, denn die kann trotz Sonnenscheins gerade im Herbst bei frischen 0 Grad liegen. Was unter anderem am Wind liegt – dem man auf vielen Routen leider nicht entkommen kann –, aber auch dem schnell hinter den umliegenden Gipfeln verschwindenden Sonnenlicht geschuldet ist.
Warum sich die Anreise trotzdem lohnt? Weil alleine das Farbenspiel des Kolob Canyons zwischen roten und gelben Sandsteinwänden ein Erlebnis ist. Und weil die Zion Canyons, bei allem, was sie den Risskletterern abverlangen, am Ende doch ein Stück weit felsgewordene Poesie sind. Nicht nur für Kletterer übrigens – das Spiel von Fels und Licht lässt sich alternativ auch erwandern. Muss aber auch nicht sein, denn im Zion Canyon gibt es genügend attraktive Möglichkeiten.
Die tragen übrigens, entgegen den Gipfeln des Nationalparks mit ihren biblischen Namen, eher weltliche Bezeichnungen. Etwa der Monkeyfinger, Sheer Lunacy oder der Iron Messiah. Unbestrittenes und für Risskletterer mit weniger Erfahrung womöglich auch unbezwingbares Highlight in den Zion Canyons ist allerdings der Moonlight Buttress – ein Fingerrriss, der über knappt 400 Meter fast gerade zum Gipfel führt. Die Mühe lohnt trotz allem, denn nach erfolgreichem Erklimmen winkt mit etwas Glück der Ausblick mit perfektem Mondschein. Der Name ist hier definitiv Programm.
Text: Sabine Kellersch

 Der Riss ins Glück: Rissklettern in Utahs Canyons (c) fotolia.com/Pabkov
Der Riss ins Glück: Rissklettern in Utahs Canyons (c) fotolia.com/Pabkov






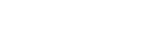
Kommentare
AW: Der Riss ins Glück: Rissklettern in Utahs Canyons
Hier spricht der "Klugscheißer"
Ein paar "Ungenauigkeiten" haben sich in den Anfang dieses Beitrags verirrt. Rissklettern hat nichts mit "Piazen" zu tun. Damit bezeichnet man die sog. "Gegendrucktechnik", die nach deutschsprachigem Verständnis von Tita Piaz "erfunden" wurde; die Franzosen bezeichnen diese Technik als "méthode dulfer" nach keinem Geringeren als Hans Dülfer, dem Erstbegeher der Fleischbank-Ost oder der Direkten Totenkirchl-West. Witzigerweise war der Erstbegeher der ersten Route in der Totenkirchl-West ein gewisser Tita Piaz, denn in der Schlüsselseillänge (V) dieser Route muss "gepiazt" werden. Aber auch im "Dülferriss" (VI–), den Hans Dülfer 1913 im Alleingang eröffnete, sollte man piazen können...
Schluss mit alpinem Geschichtsunterricht. Aber Piazen/Dülfern hat nun wirklich nichts mit dem Verklemmen irgendwelcher Körperteile in irgendwelchen Felsritzen zu tun
AW: Der Riss ins Glück: Rissklettern in Utahs Canyons
Da kann ich noch einen draufsetzen :
Im sächsischen heißt diese Technik "Hangeln"