A Long Way to a Short Cut
„Ein sicheres Mittel gegen die pathologische Hektik, die unsere moderne Welt diktiert, ist die Schaffung von Rückzugsorten, Oasen der Ruhe und Besinnlichkeit, in denen das entglittene Ich wieder zu sich finden kann.“
Normalerweise bin ich ja ein erklärter Gegner der Ratgeberliteratur - sie ist allgegenwärtig, ruft die Unzufriedenheit, gegen die sie antritt, meist selbst hervor und wenn man sie befolgt, dann aufgrund von schlechtem Gewissen oder aus Gruppenzwang. Die vermeintliche Inhaltslosigkeit wird obendrein mit pseudopoetischem Gefasel garniert.
Hinsichtlich des angeführten Auszugs aus einem dieser „live a happy life“-Machwerke, der mir im Wartezimmer des Tropeninstituts unterkam, bevor mir eine überambitionierte Jungärztin kanülenweise Antikörper in den Oberarm jagte, fühle ich mich was das Klettern betrifft, ein wenig ertappt. Das Klettern ist aber nur ein wenn auch sehr wichtiger Teil meiner persönlichen Wohlfühlkultur, zu der unter anderem auch das Kaffeetrinken gehört, was mit dem Klettern, wie Wolfgang Güllich einst scharfsinnig kundgetan hat, ein beinahe symbiotisches Wechselspiel eingeht. Weit mehr als ein banaler thermischer Vorgang, bei dem erhitztes Wasser durch Kaffeepulver diffundiert, um dann in etwas kühlerem Zustand die Kehle hinuntergekippt zu werden, hat es für mich die Form eines kleinen Zeremoniells, einer feierlichen, fast rituellen Handlung. Während der Minuten, da der Kaffee noch als Kondensat den Kannenhals hinauf kriecht und die volle Kanne mit einem beruhigenden Blubbern ankündigt, scheint die Welt in einem Zustand von unerschütterlichem Gleichgewicht zu verharren. Eine kurze Auszeit vom üblichen Wirrwarr, in der Phantasien zu gedeihen beginnen und Träume flügge werden, ohne sich von der Bezahlung der nächsten Rechnung oder dem noch immer nicht fertigen Studium niederhalten zu lassen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, was mich vor nunmehr fast zwei Jahren dazu bewegte, jenes Bild auszuschneiden, das seinen Platz von da an an der Pinwand neben meinem Herd einnehmen sollte. Wann immer ich Kaffee kochte, hat diese Abbildung des Tsaranoro Massivs in Madagaskar meine, in die Weite schweifenden Gedanken begleitet, bis sie für einen von ihnen zum Sprungbrett in jene Realität wurde, die mich Aberhunderte besinnlicher Momente und Hektoliter von Kaffee später eingeholt hatte, als ich in der Nacht des 19. September zusammen mit meinem dem Reisen und dem Koffein ebenso ergeben Freund Hari Berger den Äquator überflog.
Am nächsten Morgen landeten wir in Antananarivo, der Hauptstadt von Madagaskar. Zu unserer großen Freude gab es bei der Gepäcksausgabe keine unangenehmen Überraschungen, und auch das Treffen mit unseren Freunden Ondra Benes und Tomy Sobotka aus Aussig im Elbsandstein funktionierte wie geplant.
Das Team war komplett und wir bestiegen einen flaschengrünen Nissanbus mit dem Schriftzug „Grace“ an der seitlichen Zierleiste. Grace war ein außergewöhnliches Fahrzeug, bei dem Gaspedal und Hupe in direkter Wechselwirkung standen und die Bremse unauffindbar in den Weiten des Fußraumes verschollen blieb. Mit Höllentempo, manischem Gehupe und stoischem Gesichtsausdruck preschte unser Chauffeur Jacques mitten durch herumstreunende Hunderudel, um Haaresbreite vorbei an Ziegelstechern und Reissackträgern, trieb unschuldige Fahrradfahrer beinahe in den Straßengraben, überholte leidenschaftlich oft in uneinsehbaren, kurvigen Bergaufpassagen. Zu guter Letzt überfuhr er beinahe ein völlig verwirrtes Zebu. Geschwindigkeitsbeschränkungen gibt es in Madagaskar keine, Leitplanken, Pannenstreifen oder Polizei sind selten anzutreffen. Lediglich an den Grenzen der Bundesbezirke werden wir von Militärs in zerschlissenen Trainingsanzügen, meist ohne Schuhe, aber mit umgehängten Kalashnikovs kurz kontrolliert. Nach 10 Stunden erreichten wir Fianaranstoa, das sich den Titel „heruntergekommenste Stadt die ich je gesehen habe“ wohl nur noch von Ambalavao, das wir nach weiteren 6 Stunden durchfuhren, streitig machen lässt. Bevor wir unser Lager inmitten des Andringita Gebirges erreichen sollten, holperten wir noch weitere 2 Stunden in einem ungefederten Armeelastwagen über eine Strasse, die zerkratert war wie nach einem Bombenangriff. Die Nacht war kurz, zu kurz als dass sich mein Gesäß von dem Sitzmarathon erholen hätte können, aber Gott sei Dank war der Kaffee schon fertig. Ich blickte auf die Wand des Tsaraonoro Be, die mir als Bild zwar längst vertraut war, sich aber an diesem Morgen zum ersten Mal in ihrer wirklichen Dimension entfalten konnte. „Tsara noro“, wie das Massiv vom in dieser Gegend ansässigen Volksstamm der Bentsileo getauft wurde, bedeutet soviel wie „gute Frau“, verstehbar als eine Art Magna Mater, die sich als Schutzpatronin über das Tal erhebt.
Das Gebiet blickt bereits auf eine fast 15-jährige Erschließungsgeschichte zurück, die mit einem Besuch von Kurt Albert im Jahre 1992 begann. Seither haben sich namhafte Kletterer wie Lynn Hill oder Rolando Larcher an den Wandfluchten versucht und beeindruckende Linien bis 8b hinterlassen. Umso verwunderlicher, ja fast schon verdächtig war es, dass der zentrale Wandteil des Tsaranoro Be („Be“ = groß) von der Erschließungseuphorie noch nicht erfasst wurde. Die einzige Linie war natürlichen Ursprungs: ein schwarzer Wasserstreifen, der aussah wie eine Spur von kochendem Pech. Bei genauerem Hinsehen verstanden wir auch warum. Eine unmöglich glatt aussehende Passage nach ca. 150 m schien den Weg zum zentralen Wandteil zu versperren, unseren Erstbegehungsambitionen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber andererseits: was gab es schon groß zu verlieren?
Ein paar Tage, Nerven und Bolts. Ein Einsatz, den wir uns zu riskieren leisten konnten, nicht zuletzt, weil wir das Gefühl hatten, um den Jackpot zu spielen.
Hari und ich haben uns bereits im Vorfeld über alles Mögliche den Kopf zerbrochen. Vor allem darüber, wie der Kaffee sein wird, ob wir genug zu essen haben werden, aber auch wie es sich nach langer Zeit mal wieder anfühlen wird, im Cliff zu hängen. Eine Frage, die sich Ondra und Tomy wohl nicht zu stellen brauchten. Mit unzähligen Erstbegehungen im Sandstein bis 8b+, die mit wenig zahlreichen Eisenringen versehen sind (selbstverständlich Ground-up und ohne Bohrmaschine erschlossen), hatten sie uns einiges an Erfahrung voraus. Hari und ich hatten deswegen schon im Sommer beschlossen, uns mittels einer Erstbegehung in den heimischen Gefilden wieder an das Material zu gewöhnen. Weil wir so motiviert waren, beschlossen wir es nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, immer und immer wieder, dennoch: Deep Water Soloing in Mallorca bekam den Zuschlag. Am Sonntag, den 19. September schließlich, saßen wir kurz vor Abflug am Münchner Flughafen bei Bier und Weißwurst und versuchten uns einzureden, dass die Zeit zu knapp und das Wetter daheim ohnehin zu schlecht gewesen sei. Kein Grund zur Sorge jedoch: an Ort und Stelle, wenn wir weit, weit oben sind und in die Augen der Bestie blicken, wird uns unsere „Intuition“ schon auf den richtigen Weg führen. So hofften wir inständigst. Prost!
Einige Tage später blickte ich zum ersten Mal vom sicheren Standplatz aus in die „Augen der Bestie“. Zwischen meiner „Intuition“ und mir herrschte seit 3 Stunden Funkstille, nachdem sie mehrmals erfolglos versucht hatte, mich zum Abseilen zu überreden. Ondra, der gerade oberhalb von mir werkte, brüllte immer wieder das selbe Mantra zu mir herunter: „Oh no. Shit rock, shit rock! Watch me. This is crazy skyhook.“ Ich wollte gar nicht daran denken, wie mir die nächste Länge den Hintern versohlen würde, wenn schon Ondra, die Koryphäe des Sandsteins, solche Probleme hatte. Aber vielleicht, dachte ich mir, habe ich Glück und der Fels wird besser und ja: möglicherweise steht mir die Intuition ja zur Seite. Aber genauso gut hätte ich auf darauf hoffen können, dass die Glücksfee samt Zauberstab heranschwebt und mir meinen Wunsch erfüllt. Die nächste Länge war selbstverständlich ein ähnliches Desaster: eine Heerschar aus hohlen Schuppen, die irgendwie an der Wand klebten und nur auf das Kommando warteten losbrechen zu dürfen. Von intuitiver Leitung war auch nichts zu spüren, dafür begleitete mich in den folgenden Stunden eine unangenehm lebendige Vorstellung, die darin bestand, mitsamt Schuppe und Hilti in die Tiefe zu stürzen. Fortan vertraute ich keinem einzigen Griff länger als ein paar Sekunden und kletterte immer weiter in der verzweifelten Hoffnung auf eine Besserung der Zustände. Diese wollte aber partout nicht eintreten, was zu noch mehr Angstschweißabsonderung führte.
Gott sei Dank kam sie dann doch, die solide Leiste. Ich setzte mich in den Cliff, hielt die Luft an, atmete aus, entspannte mich und begann dann gemächlich die Maschine hinaufzuziehen. „Rock! Rock!“ brüllte Ondra plötzlich vom Stand. Das verheißt normal nichts Gutes, doch in meiner Position konnte ich weder hinaufschauen, noch ein Ausweichmanöver starten, da ich gerade das Materialseil samt Hilti zwischen den Zähnen festhielt. Ich hörte nur ein irres Sausen wie von angriffslustigen Insekten und die darauf folgende dumpfe Detonation von Stein auf Stein. Normalerweise hätte ich wohl laut geflucht oder mich bei meinem Schutzengel bedankt, aber die Maschine deswegen noch mal hinaufzuhieven zu müssen schien mir die Sache nicht wert. So biss ich die Zähne weiterhin zusammen und wunderte mich nur über die unpassende Namensgebung, denn Steine auf Fremde zu werfen gehört meiner Meinung nach nicht zu den Eigenschaften einer „guten Frau“.
Nach 55 lang(sam)en Metern war ich mit den Nerven fertig. Beim folgenden Abseilen fiel mir jene Länge auf, die Hari gestern zusammen mit Tomy eingebohrt hatte, und ich fragte mich, ob er im Vorfeld doch heimlich trainiert hatte. Irgendwie sah der Fels unangenehm kleingriffig aus und die Hakenabstände waren beinahe zweistellig. Als ich ihn später darauf ansprach, ob sein Instinkt besser sei als der meinige, verneinte er und gestand, dass er sich nicht wohl gefühlte hätte beim Cliffen auf den dünnen Schuppen und deswegen, in der Hoffnung auf bessere Zeiten, die Flucht nach vorne angetreten hatte. Interessant: trotz nicht vorhandener Vorbereitung hatten wir instinktiv dieselbe Taktik gewählt. Tomy und Ondra schienen mit dem bisherigen Fortschritt und auch mit ihren österreichischen Mitarbeitern recht zufrieden. Tomy sagte mehrmals hintereinander: „Good style, good style“ und Ondra resümierte „Hari und Flo: good workers“.
Die nächsten Tage verliefen ähnlich: wir standen im Dunkeln auf und kamen im Dunkeln zurück. Dazwischen jümarten wir in der sengenden Sonne, setzten Bolt um Bolt, arbeiteten uns Seillänge um Seillänge höher und gewöhnten uns an den Alltag in der Wand. Beim Abseilen hielten wir stets auf demselben grasbewachsenen Band inne, unserer kleinen „Oase der Besinnlichkeit“, rauchten entspannt die Feierabendzigarette, und bewunderten das Tal, das ins rosarot der letzten Sonnenstrahlen getaucht den Einbruch der Dämmerung erwartete. Das Essen war dank Haris Kochkünsten ausgezeichnet, die Stimmung war hervorragend und langsam kam ich dahinter, was Tomy meinte, wenn er das Tagwerk der erarbeiteten Längen mit „Good style, good style“ wohlwollend resümierte.
Eigentlich ist es ganz einfach zu verstehen was „good style“ bedeutet, wenn man es von „bad style“ und „optimal style“ und „ideal style“ zu unterscheiden weiß. „Ideal style“, darüber waren wir uns alle einig, wäre alle Sicherungen selbst zu legen. Es besteht kein Zweifel, dass dieser Begehungsstil derjenige ist, der sich am ehrlichsten an den Gegebenheiten des Gesteins orientiert und das meiste Können verlangt. Leider war es in unserem Fall eben dieses Gestein, dass uns den „ideal style“ versagte. Der Granit war derart kompakt, dass das einzige Placement, das ich während der Begehung unterbringen konnte ein 1er Keil war, den ich in einem Anfall von Euphorie hinter einer Schuppe in Seillänge 7 platzierte. Vielmehr als eine selbstgefällige Alibihandlung war es dann aber auch nicht, doch zumindest für die nächsten Meter konnte sie mich für das gesamte nutzlose Zusatzgewicht der Keile und Friends entschädigen, das an meinen Materialschlaufen gelangweilt vor sich hin schaukelte. Da „ideal style“ außer Frage stand, entschieden wir uns für eine Begehung in „good style“, wie er im tschechischen Sandstein und auch in den meisten modernen Felsrouten praktiziert wird: also Bohrhaken zu verwenden, wenn eine alternative Absicherung nicht möglich ist, schwierige Stellen aber stets zwingend zu klettern. Sich Bohrhaken um Bohrhaken über diese hoch zu bohren käme als „bad“ bzw. „very bad style“ nicht in Frage. „Optimal style“ wäre, um diesen Exkurs zu vervollständigen, das Anbringen des ersten Sicherungspunktes erst nach der Schlüsselstelle, wie es nur von Connaisseuren des tschechischen Elbsandstein und auch das sehr selten (etwa in der Route „President“) praktiziert wird. Um ehrlich zu sein: ich persönlich fand „good style“ gut genug. Außerdem war ich eh schon kurz davor, meinen Nerven mit einer Portion „not so good style“ Linderung zu verschaffen, wäre mir der Fels in dieser Hinsicht ein wenig wohlgesonnener gewesen. Nach endlosen Stunden des Jümarns und nur einem Sturz (der dazu führte, dass ich den Abstieg teils auf allen Vieren hinter mich brachte) war es dann soweit: die Route war fertig, die Fixseile wurden abmontiert und Tomy und Ondra holten sich die erste Begehung. Am nächsten Tag waren Hari und ich dran.
Um halb fünf Uhr stiegen wir im Schein der Stirnlampen ein. Egal wie müde man sich auch fühlen mag, die erste Länge ist aufgrund spärlicher Absicherung und eines überlangen Runouts zum Stand (Anm. „optimal style“) ein wirkungsvolles Aufwachprogramm. Nach einigen leichten Längen folgt die Schlüssellänge. Eine Folge von Pendelstürzen in den Stand, die Tomy beim Einbohren hingelegt hat, garantieren das Prädikat „good style“. Gott sei Dank bleibt uns dieses Szenario heute erspart. Um acht Uhr heizt die Sonne bereits erbarmungslos vom Himmel, die Wand flimmert wie der Nürburgring kurz vor dem Start, die Zehen fühlen sich an, wie ein Klumpen Glut, und auf unseren Gummisohlen könnte man Spiegeleier kochen. Der Spaß beginnt. Der Fels ist unberechenbar wie immer, und die Kristalleinschlüsse in den kleinen Leisten, auf denen die Finger eine Reibung haben wie ein nasses Stück Kreide auf der Schultafel, reißen uns erbarmungslos die Haut von den Fingern. Die Absicherung macht die Sache auch nicht gemütlicher und wir verfluchen die verdammten Idioten, die diese Tour eingebohrt haben, was dazu führt, dass ich des öfteren wutentbrannt meinen Namen schreie.
Natürlich geht uns knapp nach der Hälfte das Wasser aus, Gewichtsersparnis ist schließlich alles, aber irgendwie war von vornherein klar, dass eineinhalb Liter für zwei Personen in sengender Hitze nicht reichen würden.
Als die Wand in den Schatten taucht, tritt nur bedingt Linderung ein, denn: das lustigste Stück steht noch bevor. Eine nicht einmal senkrechte 7b Länge, die Tomy mit umgeschnallter Bohrmaschine geklettert ist. Cliffen war aufgrund von Griffmangel sowieso unmöglich gewesen, dementsprechend (un)kreativ ist die Absicherung. Es folgt eine weitere 7c Länge in dunklem, steilem Fels, schöne Kletterei um eine überhängende Kante, absolut empfehlenswert, wäre da nicht der unausweichliche Abschlussriss, Heimat des Stachelkaktus, der „Geißel Gottes“, der aufgrund seines opulenten Wuchses unsere wüstesten Flüche auf sich zog. Bevor man die leichte Abschlusslänge genießen kann, darf man den traurigen Rest der noch vorhandenen Nerven in einer 7b Länge verheizen, die sämtliche Unannehmlichkeiten der vorangehenden Längen - Dornen statt Griffe sowie diffizile Reibungskletterei mit halbgeschmolzenen Sohlen - vereint. Zweifellos „very good style“.
Nach knapp 12 Stunden Kletterei erreichen Hari und ich den Gipfel. Wir stehen einander gegenüber wie zwei Boxer in der 15. Runde in Erwartung des Knockout-Punches. Der Wind bläst wie wild, wir schauen in die unbändige Weite des Landes, blinzeln in die untergehende Sonne und finden es schön, dass wir oben angelangt sind. Dann umarmen wir uns und im folgenden wortlosen Moment hoffen wir dasselbe: dass sich das Glücksgefühl retrospektiv einstellen möge. Dann seilen wir ab. Den hart erkämpften Rasttag verbrachten wir mit Essen, Schlafen, Topo Zeichnen und Diskussionen über Stil und Schwierigkeiten der einzelnen Seillängen. Folgendes ist dabei herausgekommen: „Shortcut“, 800 m, (Seillängenschwierigkeiten im Einzelnen, obl Bewertung???)
Gott sei Dank waren wir Meister der Beschäftigungstherapie. Hari und Ondra hatten schon ein neues Projekt gefunden: die Route „Bravo les Filles“ 8b, die von Lynn Hill, Beth Rodden und Nancy Faegan erstbegangen wurden. Hari und Ondra holten sich jeder eine Wiederholung dieser 600 m Linie - dazu ist kaum mehr zu bemerken als „Bravo les Fils“. Thomy und ich hatten ein breiteres Spektrum an Aktivitäten: zuerst einmal jagten wir unsere Immunabwehr heldenhaft in die Schlacht gegen allerlei Bakterienstämme, was mit einer zweimaligen Niederlage auf Seiten der Menschen endete. Wieder genesen praktizierten wir mit Hingabe das so genannte „Short-cutting“, was soviel bedeutet, wie den ausgetretenen Weg mutwillig in Hinblick auf eine vermeintlich imaginäre Abkürzung hin zu verlassen. Immerhin: Dschungel und Savanne erlebten wir intensiver als die meisten anderen und wenn wir dann doch einmal wieder die Wand zu Gesicht bekamen, versuchten wir uns an diversen vorhandenen Routen („Mai piu cosa“ von Rolando Larcher oder „Vazaha m`Tapi tapi“ von Toni Arbones), hatten aber mit der Kombination von 700 m Wandhöhe und Schwierigkeiten bis 8a+ unsere liebe Mühe. Immerhin gelang eine Onsight-Begehung von „Always the Sun“ 7c+ an der benachbarten Wand des Karambony.
Es folgte ein Ortswechsel in den Norden, wo wir zwei in jeder Hinsicht paradiesische Wochen verbrachten, und dann ging es nach insgesamt sechs Wochen auf der „roten Insel“ wieder heim. Zurück in den kühlen November, von der Board Short in die Daunenjacke, zurück auch zum Ort wo alles begann: an meinen geliebten Herd, wo ich vom morgendlichen Duft frischer Bohnen benebelt auf die nächste Eingebung des Orakels warten werde.
Facts:
Team: Florian Scheimpflug, Tom Sobotka, Ondra Benés, Hari Berger
Location: Madagascar, Andringitr National Park, Tsaranoro Be, Karamboli
First ascent of “Short Cut” 750 m, 7c+, 16 pitches (11p. over 7a)
Second and third free ascent of “Bravo les Filles” 600 m, 8b, 14 pitches: Hari and Ondra
Probably first Wingsuit Base of Tsaranoro Be: Hari
Text: Flo Scheimpflug Photos: Hermann Erber, Hari



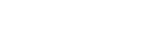
Kommentare